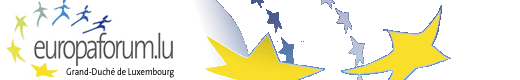Emploi et politique sociale
Europäische Rechtsakademie (ERA), Tagung Sozial- und Steuerrecht für Grenzgänger, 16. und 17. März 2006
16-03-2006
Mobilität beruflicher Grenzgänger in der EU: Welche Hürden sind noch zu nehmen?
Die EU hat 2006 zum „Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer“ erklärt. Ein echter europäischer Arbeitsmarkt wird in der Praxis aber oft von ungeklärten rechtlichen Fragen behindert. Eine Tagung der Europäischen Rechtsakademie (ERA) am 16. und 17. März 2006 in Trier beschäftigte sich mit der Situation der von dieser Situation am stärksten betroffenen Arbeitnehmer, der Grenzgänger.
Der Anteil der Berufspendler zwischen EU-Ländern unter Europas Arbeitnehmern ist mit 0,2 Prozent für die alten Mitgliedesländer noch niedrig, allerdings mit steigender Tendenz. Angesichts von Globalisierungsdruck und wirtschaftlichen Umstrukturierungen ist in Europa mit einer weiteren Flexibilisierung der europäischen Arbeitsmärkte zu rechnen. Ziel des „Europäischen Jahres der Mobilität der Arbeitnehmer“ ist es daher, alle beteiligten Akteure (Grenzgänger, Behörden, Sozialpartner) für die Rechte der Arbeitnehmer im Hinblick auf die Freizügigkeit von Personen zu sensibilisieren und zu prüfen, wo noch Hindernisse liegen.
Beispiel: Region Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz
Nirgendwo lassen sich die Schwierigkeiten auf dem Weg zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt besser studieren als in den Grenzregionen zwischen den alten EU-Ländern, in denen das berufliche Pendeln zwischen dem Land des Wohnsitzes und dem Land des Arbeitsplatzes für viele Arbeitnehmer seit Jahren Realität ist. Mit mehr als 100.000 Pendlern täglich (Quelle: EURES) ist die Region Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz die Grenzregion mit den meisten Grenzgängern in der EU.
Online-Forum für Grenzgänger
In einem Online-Forum hat die ERA vorab praktische Beispiele rechtlicher Probleme von Grenzgängern aus den Bereichen Sozialversicherung und Steuerrecht gesammelt. Eine Mehrzahl der Beiträge stammt von Grenzgängern zwischen Deutschland und Luxemburg.
Zwei typische Beispiele:
- In Luxemburg beschäftigte Pendler aus Deutschland können Darlehenszinsen für ihre selbst genutzten Immobilien in Deutschland in Luxemburg nicht von der Steuer absetzen. Damit sind sie benachteiligt gegenüber Arbeitnehmern mit Wohnsitz in Luxemburg, aber auch gegenüber Pendlern aus Belgien, die ihre Immobilienkosten in Luxemburg von der Steuer absetzen können.
- Besteuerung von Alterseinkünften: In bestimmten Fällen kann es dazu kommen, dass deutsche Grenzgänger im Ruhestand mit einer Besteuerung ihrer aus einem Arbeitsverhältnis in Luxemburg stammenden Rente (oder Witwenrente) rechnen müssen, auch wenn sie die Beitragszahlungen während des Erwerbslebens in Luxemburg nicht von der Steuer absetzen konnten.
Kernaussagen der Tagung
In den meisten Fällen entstehen Probleme nicht aus einem Mangel an rechtlichen Regelungen, sondern dadurch, dass sich Gesetzgebung überschneidet und es noch zu wenig Koordination zwischen Finanzämtern und Sozialversicherungsträgern der Mitgliedsländer gibt.
Die europäische Koordination im Bereich der Sozialversicherung ist wesentlich weiter fortgeschritten als im Bereich des Steuerrechts. Die europäische Koordinierungsverordnung 1408/71 regelt die Rechte von grenzüberschreitenden Arbeitnehmern und ihren Familienmitgliedern. Sie verhindert, dass die erworbenen Rechte auf Sozialleistungen bei der grenzüberschreitenden Mobilität verloren gehen, bezieht sich allerdings nur auf die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme, nicht auf privat erworbene Zusatzleistungen. Steuerrechtliche Fragen sind dagegen nicht auf europäischer Ebene, sondern in etwa 600 Doppelbesteuerungsabkommen (DBAs) zwischen den Mitgliedsländern bilateral geregelt.
Doppelbesteuerungsabkommen können aber nicht alle Fallkonstellationen abdecken und müssen deshalb immer wieder ergänzt werden, so durch Regelungen für einzelne Berufsgruppen. In der Praxis ergeben sich außerdem Probleme durch die unterschiedliche Auslegung der Rechtsbegriffe der Doppelbesteuerungsabkommen in den Mitgliedsländern und durch unterschiedliche Regelungen in den einzelnen DBAs, die sich an den jeweiligen nationalen Rechtsbegriffen orientieren. „Der Steuergesetzgeber scheint stark der nationalen Systematik verhaftet, nicht nur in Deutschland“, sagt Johannes Gasber, stellvertretender Leiter des Finanzamtes Trier.
Im Steuerrecht gibt es bisher kaum Koordination auf europäischer Ebene. Koordinierungsdruck auf die Mitgliedstaaten ergibt sich aus dem Fallrecht der letzten 15 Jahre seit Inkrafttreten des EU-Vertrages. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung (Artikel 12 EU-Vertrag) ist Ausgangspunkt für Klagen vor dem EuGH bei Nichtgleichbehandlung in Steuerfällen. So war beispielsweise der Fall Schumacker (C-279/93) ein Meilenstein für die steuerliche Gleichstellung von Grenzgängern mit Ortsansässigen.
Nach Auffassung Stephan Wonnebauers, Fachanwalt für Steuerrecht in Trier, ist zu erwarten, „dass das luxemburgische Steuerrecht so geändert wird, dass Grenzgänger in Luxemburg bei der Behandlung von Immobilienkosten nicht mehr steuerlich benachteiligt werden.“ Wonnebauer hebt außerdem hervor, dass Luxemburg-Pendler generell eher bevorzugt als benachteiligt seien. Ein Problem allerdings sieht er darin, dass Vorschriften oftmals nicht bekannt seien, auch vielen Steuerberatern nicht. Dringendsten Handlungsbedarf sieht er demzufolge nicht bei der Gesetzgebung, eher sei „Fortbildung auf Seiten der Berater und Finanzbehörden erforderlich, um die bestehenden Vorschriften und Urteile kennen zu lernen.“
Die Verbindung von Problemen aus dem Bereich Steuerrecht und Sozialversicherung in der Praxis macht eine Lösung kompliziert und von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Nach Einschätzung von Ger Essers, Berater des Kooperationsnetzes für die Mobilität von Beschäftigen in der EU, EURES, ist ein Hauptproblem der Mangel an Abstimmung zwischen bestehenden Koordinierungsmechanismen im Bereich der Sozialversicherung einerseits und bei der Besteuerung andererseits. Die in der Verordnung zur Koordinierung der Sozialversicherung enthaltene Grenzgängerdefinition sei weiter gefasst als diejenige, die in den Doppelbesteuerungsabkommen verwendet wird. Dies führe oft zu falschen Schlüssen. Essers schlägt als denkbaren Weg für die Koordination der Besteuerung von Grenzgängern in allen Mitgliedstaaten der EU ein europäisches Musterabkommen vor.
Die Europäische Rechtsakademie
Die Europäische Rechtsakademie (ERA) fördert das Bewusstsein, das Verständnis und die Anwendung des EU-Rechts, indem sie Rechtspraktikern - Richtern und Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Juristen aus Wirtschaft und Verwaltung sowie Wissenschaftlern und anderen mit Rechtsthemen befassten Personen - eine Fortbildungs- und Diskussionsstätte bietet. Durch Tagungen, Seminare, Studienbesuche, Sprachkurse sowie Veröffentlichungen stellt die Akademie eine Schnittstelle zwischen den europäischen Rechtsanwendern und den europäischen Entscheidungszentren in Brüssel, Luxemburg und Straßburg dar. Die ERA wurde 1992 auf Initiative des Europäischen Parlaments als öffentliche Stiftung gegründet, der heute ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten angehört.